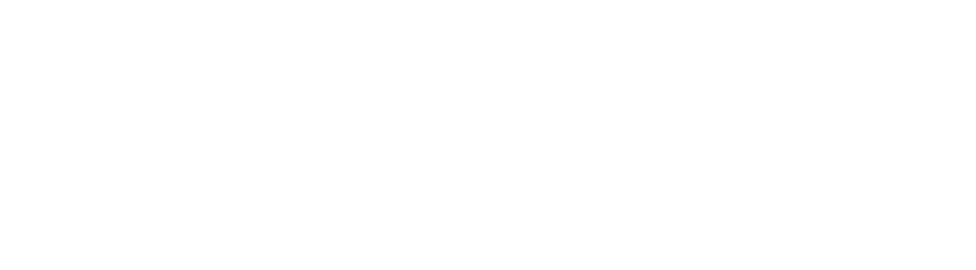Das Reh (Capreolus capreolus) ist die häufigste und zugleich kleinste Hirschart in Europa und gilt als die am weitesten verbreitete Schalenwildart. Es gehört zur Familie der Hirsche (Cervidae) und bildet zusammen mit Elch und Rentier die Gruppe der Trughirsche. Man unterscheidet das Europäische Reh, das Sibirische Reh und das Mandschurische Reh. Die Tiere sind von graziler, schlanker Statur. Ein ausgewachsenes Reh erreicht eine Schulterhöhe von etwa 60 bis 80 Zentimetern und ein Gewicht zwischen 15 und 30 Kilogramm. Das Männchen wird als Rehbock, das Weibchen als Ricke oder Geiß bezeichnet. Die Jungen sind die Kitze.
Äußeres Erscheinungsbild und Gehörn
Die Fellfarbe des Rehes variiert je nach Jahreszeit. Im Sommer präsentiert es sich in einem auffälligen Rotbraun, während es im Winter ein unauffälligeres Graubraun annimmt, was der Tarnung dient. Ein charakteristisches Merkmal ist der sogenannte Spiegel am Hinterteil, ein Fleck aus weißen oder gelblichen Haaren, der besonders im Winter deutlich zu erkennen ist. Nur die Rehböcke tragen ein Geweih, das in der Jägersprache als Gehörn bezeichnet wird. Dieses wird jedes Jahr, meist im Herbst, abgeworfen und wächst im Frühjahr neu. Während des Wachstums ist es von einer nährenden Haut, dem sogenannten Bast, umgeben. Das Gehörn des Rehbocks ist verhältnismäßig klein und dient primär zur Austragung von Revierkämpfen und zur Markierung des Territoriums.
Lebensweise und Ernährung
Das Reh ist ein Pflanzenfresser und gehört zu den Wiederkäuern. Es gilt als wählerischer Konzentratselektierer, der energie- und nährstoffreiche Nahrung bevorzugt. Dazu zählen zarte Gräser, Kräuter, junge Triebe, Knospen, Blätter sowie Wald- und Feldfrüchte. Rehe sind anpassungsfähig und besiedeln unterschiedliche Lebensräume, von der Agrarlandschaft über Auwälder bis hin zu Bergwäldern. Sie bevorzugen jedoch strukturreiche Habitate wie Waldlichtungen und Waldränder, von wo aus sie schnell im schützenden Dickicht verschwinden können. Die Tiere sind überwiegend dämmerungsaktiv, wobei sie früh morgens und abends bei der Nahrungsaufnahme zu beobachten sind. Zwischen den Mahlzeiten ziehen sie sich in die Deckung zurück, um ungestört wiederkäuen zu können.
Fortpflanzung und Kitze
Die Paarungszeit, auch Blattzeit genannt, findet in der Regel im Juli und August statt. Eine Besonderheit in der Fortpflanzung des Rehes ist die Keimruhe oder Eiruhe. Nach der Befruchtung entwickelt sich die Eizelle zunächst verzögert. Erst ab etwa Dezember beginnt die eigentliche Embryonalentwicklung, was die Tragzeit auf insgesamt etwa neuneinhalb Monate verlängert. Diese zeitliche Steuerung stellt sicher, dass die Kitze – meist eins bis drei, häufig zwei – im späten Frühjahr, in den Monaten Mai oder Juni, geboren werden, wenn das Nahrungsangebot am besten ist. Die Kitze tragen ein braunes Fell mit hellen, tarnenden Flecken. Sie sind typische Ableger und folgen der Mutter nicht sofort, sondern verharren regungslos im hohen Gras, um vor Fressfeinden geschützt zu sein.
Bedrohungen
Das Reh sieht sich heute mit einer Vielzahl von Bedrohungen konfrontiert, die sein Überleben und seine Population beeinflussen. Zu den natürlichen Feinden zählen Beutegreifer wie Wolf, Luchs und Bär, aber auch Schwarzwild und der Steinadler können eine Gefahr darstellen, besonders für die Kitze. Eine erhebliche Gefahr geht jedoch vom Menschen und seinen Aktivitäten aus. Hierbei ist der Straßenverkehr eine der häufigsten Todesursachen, da Rehe beim Überqueren von Fahrbahnen, insbesondere in der Dämmerung, oft in Wildunfälle verwickelt werden.
Ein weiteres dramatisches Problemfeld ist die moderne Landwirtschaft. Im Frühjahr und Frühsommer legen Ricken ihre Kitze schutzsuchend im hohen Gras und auf Wiesen ab. Da die Jungen instinktiv regungslos verharren, anstatt zu fliehen, fallen sie tragischerweise häufig den Mähwerkzeugen bei der Heu- und Grasernte zum Opfer. Trotz des Einsatzes moderner Technik wie Drohnen mit Wärmebildkameras stellt der sogenannte Mähtod nach wie vor ein großes Tierschutzproblem dar.
Zusätzlich können wildernde Hunde Rehe hetzen, schwer verletzen oder töten, was eine massive Störung und Gefahr im Lebensraum der Wildtiere darstellt. Auch Krankheiten und Parasitenbefall sowie die Auswirkungen von extremen Witterungsbedingungen und dem Einfluss der Bestandsdichte können die Populationen des Rehs negativ beeinflussen. Die Störungen durch den Menschen, sei es durch Freizeitaktivitäten in den Wäldern oder die Zerstörung von Lebensraum, tragen ebenfalls zur Gefährdung der scheuen Wildtiere bei.