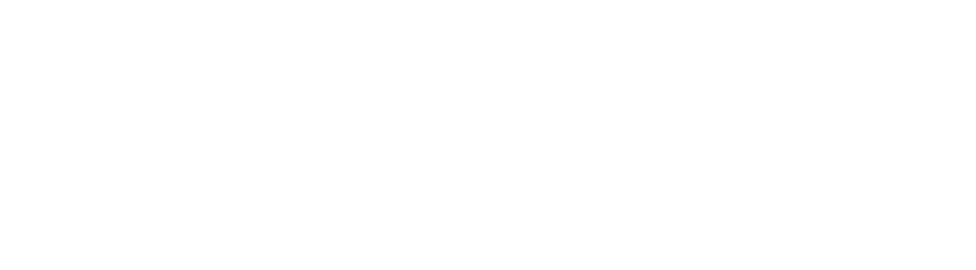Der Bienenfresser ist zweifellos einer der auffälligsten und farbenprächtigsten Vögel Europas, der durch sein exotisches Aussehen an Vögel aus tropischen Regionen erinnert. Er gehört zur Familie der Bienenfresser (Meropidae), von denen er die einzige Art ist, die regelmäßig in Europa brütet.
Erscheinungsbild und Merkmale
Der Bienenfresser ist etwa amselgroß (ca. 25-29 cm lang) und schlank. Seine Gesamterscheinung ist schlank und elegant, mit einem relativ langen, dünnen, leicht nach unten gebogenen schwarzen Schnabel. Auffällig ist sein Gefieder, das in einer reichen Palette leuchtender Farben strahlt. Die Oberseite des Kopfes und der Nacken sind kastanienbraun und gehen in einen grünlichen Rücken über. Die Schulterfedern und der untere Rücken zeigen oft goldgelbe und rostrote Töne. Ein charakteristisches Merkmal ist die schwarze Augenmaske, die sich vom Schnabel bis hinter das Auge erstreckt.
Darunter befindet sich eine türkisblaue oder hellblaue Kehle, die durch ein schmales, schwarzes Band vom leuchtend gelben Kinn abgesetzt ist.Die Unterseite ist in der Regel türkisblau oder grünblau. Die Flügel sind lang und zugespitzt, wobei die Handschwingen grünblau erscheinen und die Armschwingen rötlich-braun sind. Im Flugbild ist besonders der lange, gegabelte Schwanz auffällig, dessen mittlere Federn oft etwas verlängert sind. Dieses prachtvolle Federkleid macht den Bienenfresser zu einer der auffälligsten Erscheinungen in der europäischen Vogelwelt .
Verbreitung und Lebensraum
Der Bienenfresser bevorzugt warme, offene und sonnige Landschaften mit vereinzelten Bäumen oder Büschen als Sitzwarten. Sein ursprüngliches Hauptverbreitungsgebiet liegt in Süd- und Südosteuropa, Nordafrika und Westasien. Als Profiteur des Klimawandels breitet er sich jedoch zunehmend nach Norden aus und ist mittlerweile in einigen Teilen Mitteleuropas, wie Deutschland und Österreich, wieder regelmäßiger Brutvogel.
Als Langstreckenzieher überwintert der Europäische Bienenfresser südlich der Sahara, hauptsächlich in Westafrika bis nach Angola. Er kehrt meist zwischen April und Mai in seine Brutgebiete zurück und beginnt bereits im August mit dem Zug in seine Winterquartiere.
Brut und Fortpflanzung
Der Bienenfresser ist ein geselliger Vogel, der meist in Kolonien brütet, die von wenigen Paaren bis zu größeren Gruppen reichen können. Für seine Brut benötigt er Steilwände oder Abbruchkanten aus weichem Material wie Löss, Lehm oder Sand, die er oft in Kies- oder Sandgruben, an Böschungen oder natürlichen Uferabbrüchen findet.
Brutröhre: Das Brutpaar gräbt gemeinsam eine bis zu 1,5 oder sogar 2 Meter lange, leicht ansteigende horizontale Röhre in die Steilwand, die in einer erweiterten Nestkammer endet. Dieses Bauwerk ist eine enorme Leistung, für die sie etwa zwei bis drei Wochen benötigen.
Brut: Es wird nur eine Brut pro Jahr großgezogen. Das Weibchen legt in der Regel 5 bis 7 Eier. Die Brutdauer beträgt etwa 20 bis 25 Tage, und die Jungvögel verlassen das Nest nach weiteren 20 bis 25 Tagen.
Ernährung und Jagd
Wie sein Name vermuten lässt, ernährt sich der Bienenfresser hauptsächlich von großen Fluginsekten, wobei Hautflügler wie Bienen, Hummeln und Wespen einen bedeutenden Teil seiner Nahrung ausmachen. Auch Libellen, Schmetterlinge und Käfer stehen auf seinem Speiseplan.
Jagdstrategie: Der Bienenfresser ist ein äußerst geschickter Luftjäger. Er beobachtet das Gelände von einer erhöhten Sitzwarte (Ast, Draht, Mast) aus. Hat er ein Insekt erspäht, startet er zu einem schnellen Jagdflug und fängt die Beute meist in der Luft.
Umgang mit Gift: Um wehrhafte Beute wie Bienen oder Wespen unschädlich zu machen, fliegt der Vogel zurück zu seiner Warte. Dort schlägt und reibt er das Insekt kräftig auf einer Unterlage. Dadurch wird der Stachel entfernt und das Gift aus der Giftdrüse des Insekts gedrückt, bevor der Bienenfresser die Beute verschluckt oder an seine Jungen verfüttert.
Schutz und Besonderheiten
In Deutschland galt der Bienenfresser zeitweise als ausgestorben, doch seit den 1990er Jahren wandert er wieder ein. Er profitiert von warmen Sommern und dem Vorhandensein geeigneter Brutplätze wie aufgelassener Gruben. Sein Bestand gilt in Europa derzeit als stabil oder nicht gefährdet, wenngleich er in manchen Regionen noch selten ist. Der Schutz seiner Kolonien, insbesondere in aktiven oder ehemaligen Abbaugebieten, ist wichtig für seine weitere Verbreitung.