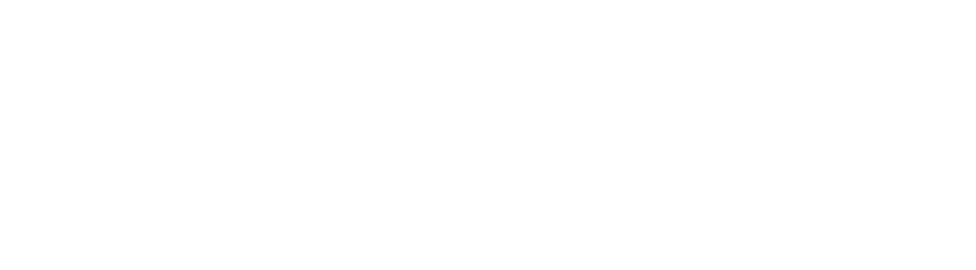Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) ist das am weitesten verbreitete Raubtier in Mitteleuropa und hat sich dank seiner erstaunlichen Anpassungsfähigkeit in nahezu allen Lebensräumen etabliert, von dichten Wäldern bis hin zu städtischen Gebieten. Er gehört zur Familie der Hundeartigen, weist aber mit seinen schlitzförmigen Pupillen und der Art, wie er mit seiner Beute spielt, auch katzenartige Züge auf. Der Fuchs ist ein geschickter Jäger und wird nicht umsonst als „schlau wie ein Fuchs“ bezeichnet.
Erscheinungsbild und Sinnesleistungen
Typisch für den Rotfuchs ist sein rötlich-braunes Fell, wobei die Färbung je nach Region und Jahreszeit leicht variieren kann. Brust, Bauch und die Spitze des langen, buschigen Schwanzes – in der Jägersprache Lunte genannt – sind meist weiß. Die Rückseiten der Ohren und die Beine sind oft dunkel bis schwarz gefärbt. Ausgewachsene Füchse erreichen eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 60 bis 90 Zentimetern, eine Schulterhöhe von bis zu 50 Zentimetern und wiegen im Durchschnitt zwischen fünf und zehn Kilogramm.
Besonders hervorzuheben sind die hervorragenden Sinnesleistungen des Fuchses: Er besitzt einen Geruchssinn, der um ein Vielfaches besser ist als der des Menschen, und ein extrem feines Gehör, mit dem er Mäuse sogar unter einer Schneedecke oder im hohen Gras lokalisieren kann. Seine Augen sind optimal an die Dämmerung und die Nacht angepasst.
Lebensweise und Ernährung
Füchse sind primär dämmerungs- und nachtaktiv, können aber, insbesondere während der Jungenaufzucht oder bei Nahrungsknappheit, auch tagsüber beobachtet werden. Entgegen der früheren Annahme, dass sie Einzelgänger seien, leben Füchse meist in kleinen Familiengruppen, die aus einem Rüden, einer Fähe und den Jungtieren bestehen, wobei oft nur das dominante Weibchen Nachwuchs bekommt. Sie errichten oder nutzen unterirdische Bauten, sogenannte Fuchsbauten, als geschützte Rückzugsorte, vor allem für die Aufzucht der Jungen.
Als Allesfresser ist der Fuchs bei der Wahl seiner Nahrung nicht wählerisch. Sein Speiseplan besteht hauptsächlich aus Kleinsäugern wie Mäusen und Kaninchen, aber auch aus Vögeln, Eiern, Insekten, Regenwürmern, Früchten, Beeren, Aas und in Siedlungsnähe auch menschlichen Abfällen. Diese Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Nahrungsquellen ist ein Schlüssel zu seinem Erfolg als Überlebenskünstler. Beim Mäusefang zeigen Füchse einen charakteristischen Mäusesprung, bei dem sie die Beute durch einen steilen Sprung aus der Luft überwältigen.
Fortpflanzung und Bedeutung
Die Paarungszeit, die Ranzzeit, liegt meist zwischen Dezember und Februar. Nach einer Tragzeit von etwa 50 Tagen bringt die Fähe im März oder April durchschnittlich drei bis sechs Fuchswelpen zur Welt. Die Jungen kommen blind und taub zur Welt. Ihre Augen öffnen sich nach etwa zwei Wochen, und nach vier Wochen beginnen sie, den Bau zu erkunden. Sie bleiben bis in den Herbst oder das nächste Frühjahr bei der Familie, bevor sie abwandern und ihr eigenes Territorium suchen. In der Natur erfüllt der Fuchs eine wichtige Funktion als „Gesundheitspolizei“, da er vor allem kranke, schwache oder verletzte Tiere erbeutet und somit zur natürlichen Auslese beiträgt.
Bedrohungen
Obwohl der Fuchs als überaus anpassungsfähiges Wildtier heute nicht als bedroht gilt und seine Populationen sich nach dem erfolgreichen Ende der Tollwut-Epidemien stark erholt haben, sieht er sich dennoch verschiedenen Herausforderungen ausgesetzt. Die Tollwut ist in Deutschland durch flächendeckende Impfungen in den Fuchsbeständen erfolgreich eliminiert worden, aber andere Krankheiten wie die Fuchsräude und die Staupe können lokal zu teils drastischen Bestandseinbrüchen führen. Auch der Fuchsbandwurm spielt in Bezug auf die Übertragung auf den Menschen eine Rolle, weshalb Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Wildfrüchten oder toten Tieren empfohlen werden.
Die Bejagung des Rotfuchses ist ein weiterer signifikanter Faktor, der die Population beeinflusst, wobei Jäger oft argumentieren, dies sei zum Schutz von Niederwild wie Hasen und Rebhühnern notwendig. Die Jagdstatistik weist jährlich hohe Zahlen erlegter Füchse auf. Neben der gezielten Jagd stellt auch der Straßenverkehr eine der größten nicht-natürlichen Todesursachen für den Fuchs dar, da viele Tiere beim Überqueren von Verkehrswegen ums Leben kommen.
Darüber hinaus führen die Zerstörung und Zerschneidung natürlicher Lebensräume durch Siedlungsbau und intensive Landwirtschaft, sowie der Rückgang des Nahrungsangebots durch das Insektensterben und die veränderte Agrarlandschaft, zu indirektem Stress und Herausforderungen für den Fuchs. Trotz seiner hohen Anpassungsfähigkeit, die ihm das Leben als Kulturfolger sogar in städtischen Gebieten ermöglicht, sind dies fortlaufende Bedrohungen für das Wildtier.